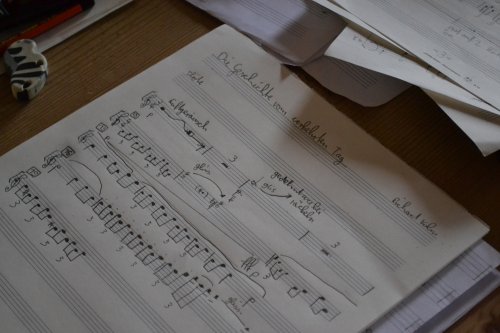Die »Komponistenklasse Dresden« wird seit über zwanzig Jahren von der Komponistin Silke Fraikin geleitet. Acht- bis 19jährige Schülerinnen und Schüler aus dem sächsischen Raum treffen sich unter ihrer Anleitung regelmäßig zu Workshops und Ferienkursen, die schlussendlich in Uraufführungskonzerte mit Profi-Musikern münden.
"Welten der Natur" hieß das jüngste davon; in Chemnitz und Dresden kamen jeweils Freunde, Familie und sonstige Neugierige zusammen, um sechzehn neuen Werken von vierzehn jungen Komponisten zu lauschen. Unterschiedliche Besetzungen vom Solowerk bis hin zum Septett wurden aus einem instrumentellen Pool gebildet, der wohl den Komponisten für das aktuelle Projekt vorgegeben war, und den Musiker der Dresdner Sinfoniker bildeten: darin eine Flöte und eine Okarina (Katrin Paulitz), eine Klarinette bzw. ein Saxofon (Friedemann Seidlitz), Schlagwerk (Ulrich Grafe), zwei Bratschen (Caroline Kersten und Ulrich Milatz) und zwei Kontrabässe (Michael Poscharsky und Tom Götze), wobei letzterer auch zur Bassgitarre oder zur Tuba griff.
In der Rückschau auf das Konzert im Festspielhaus Hellerau lassen sich ein paar Aspekte festhalten, die interessant wären, einmal mit Silke Fraikin, mit den Zuhörern und Musikern zu debattieren. Zuerst wäre da vielleicht die Frage, ob die jungen Komponisten die Spielräume an möglichen Besetzungen, der Instrumentenbehandlung und nicht zuletzt der Vorstellung, was eine Komposition heute ausmacht und was sie begrenzt, ausführlich genug reflektiert haben. Ich meine: nein. Wohl kratzten einige Werke vorsichtig an etablierten instrumententechnischen Grenzen; bearbeiteten die Bratscher ihre Instrumente gegenseitig, und hörten wir ein kleines Tamtam unter Wasser. Allein blieben doch viele Gewohnheits-Zäunchen, die anderswo längst eingerissen sind, hier stehen; für hochgezogene Augenbrauen sorgte schon die Bewegung einzelner Interpreten im Raum. Was, wenn sie daneben Einrad gefahren wären oder bunten Sand aus ihren Taschen rieseln lassen hätten, wenn sie in ihre Instrumente gesungen, das Publikum zur Interaktion aufgefordert hätten oder mit dem Raum, seiner Akustik und seiner Kubatur stärker interagiert hätten?
Ockhams Rasiermesser
Es wäre – zweitens – nicht schwer, die gehörten Werke in dem Klangraum, den sie selbst aufmachen, innerhalb der Grenzen, die sie selbst sich stecken, unter Anleitung weiter zu straffen, Pointen stärker herauszuarbeiten, Spannungsbögen zu putzen. Man fragt sich: ist das nicht gewollt, oder fehlte vielleicht die Zeit dazu? Sollte eine noch eher unerfahrene Komponistin darauf hingewiesen werden, wenn sie es den Interpreten unnötig schwer macht, weil sie noch nicht gelernt hat, Rücksicht zu nehmen auf Instrumentenregister, technische Herausforderungen, allgemein auf die Entwicklung der kompositorischen Dichte innerhalb eines Werkes? Wenn sie andererseits zwei Instrumente umständlich erledigen lässt, was eines von ihnen spielend schaffen würde? Oder wenn in einem Stück alle möglichen spannenden künstlerischen Mittel nur angedeutet bleiben (Johannes Conrad: »Zelda's Traum« für Okarina/Flöte und zwei Bratschen), nichts zuendegedacht wird? So wird beispielsweise auch Jan Arvid Prée sein »Septett op. 71« später vielleicht verwerfen, da dessen musikalischer Ablauf allzusehr durch aufgestellte Regeln dominiert und beschränkt ist; so bleibt das Septett beim Durchexerzieren, statt ins schwerelose Gleiten zu finden.
Drittens wäre die Frage zu bedenken, wie man als Mentor mit unfreiwilliger Komik in den entstehenden neuen Werken umgeht? Oder mit stilistischen Banalitäten? Macht man sie den jungen Zeitgenossen während des Kompositionsprozesses bewusst, oder lässt man sie ins Messer laufen? Das geht hinunter bis zur Formulierung des eigenen Lebenslaufs: hier gibt etwa einer der Komponisten an, seine Interessen seien "Philosophie und Calvin Klein". Eine Anregung wäre, diese Dinge einmal mit den Komponistenklassenkameraden zu thematisieren, Genrediskussionen anzustoßen, regelmäßiger eine Werkkritik "von außen" zu pflegen bzw. standardmäßig in den Entstehungsprozess neuer Werke einzubeziehen.
Zuletzt sollen zwei Werke benannt sein, die ich unbedingt zu den besten des Abends zählen möchte. Sie stammen beide von der mit Abstand jüngsten Komponistin der Klasse, Mara Wiegleb (geb. 2005). Ihr Stück "Die faule und die schnelle Maus" ist eine superwitzige Miniatur für zwei Instrumente (Altflöte und Klarinette); mit wenigen Tönen ist hier alles gesagt, die Pointe sitzt, das Stück hat Pep, Leichtigkeit und nimmt sich nicht zu wichtig. (Schade bloß, dass es auf einem längeren Grundton endet – so sind Mäuse nicht). Stärker noch wirkt das kurze "Träume träumen", das, so schreibt Mara, von dem kleinen Mädchen Luisa handelt. Luisa liegt im Bett und träumt vom Schlaraffenland, ihre Mama weckt sie auf. Was andere umständlich mit verschiedenen Instrumenten zu umschreiben versucht hätten, schafft die Komponistin mit einer Solobratsche (Ulrich Milatz) – und mehr oder weniger drei Tönen. Aus ihnen erwächst eine ganze Klangtraumlandschaft. Hut ab!
Martin Morgenstern